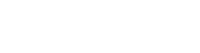Projektpartner Regenwurm: Bioland-Forschungsprojekt „VermiSoilBiome“

Die einseitige landwirtschaftliche Bodennutzung führt weltweit zu einem dramatischen Rückgang der fruchtbaren Humusschicht. Neuere Erkenntnisse zur zentralen Rolle des Bodenmikrobioms und seiner unzähligen Kleinstorganismen haben die Nachfrage nach mikrobiell wirksamen Düngemitteln verstärkt. Genau hier setzt das im September 2024 gestartete, dreijährige Forschungsprojekt der Bioland Stiftung an. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München und der TUM School of Life Sciences in Weihenstephan untersucht es, wie Wurmkompost zur schonenden Nutzung des Bodenmikrobioms beitragen kann. Ziel ist es, kostengünstige und doch hochwirksame Methoden zur natürlichen Pflanzenstärkung zu entwickeln, die gleichzeitig zum Humusaufbau beitragen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, thermischen Kompostierungsprozessen übernehmen bei der Vermikompostierung Kompostwürmer die Zersetzung organischer Materialien. Dadurch entfallen teure und arbeitsintensive Prozesse wie das Wenden des Rottematerials. Stattdessen arbeiten sich die Würmer schichtweise durch das Substrat und hinterlassen einen besonders humusreichen Kompost. Diese Methode eignet sich nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, sondern kann auch in kleinen Balkonanlagen oder großen, automatisierten Kompostsystemen genutzt werden.
„Seit 200 Millionen Jahren verrichten Regenwürmer ihre Arbeit in natürlichen Kreisläufen – effizienter und nachhaltiger als jedes industrielle Verfahren“, erklärt SAGST-Projektleiterin Anne Bresser. „Unser Projekt soll zeigen, wie Vermikompost als nachhaltige Methode zur Bodenverbesserung weltweit eingesetzt werden kann. Denn wir brauchen eine widerstandsfähigere Landwirtschaft, die auf die Stärke der Natur setzt, anstatt von industriellen Präparaten abhängig zu sein.“
Derzeit laufen Untersuchungen auf fünf ökologischen Betrieben in Deutschland, darunter auch der biodynamisch wirtschaftende Schönberghof in Rosenfeld (Zollernalbkreis). Im Rahmen der Studie wird die mikrobielle Zusammensetzung von Vermikompost analysiert und mit anderem Kompost verglichen. Anschließend folgen Gefäßversuche im Gewächshaus, um die optimalen Anwendungsformen für die Kulturpflanze Gerste zu ermitteln. In einem letzten Schritt testen Feldversuche die langfristigen Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit. Bis Sommer 2027 sollen alle Versuchsphasen abgeschlossen sein – mit dem Ziel, praxistaugliche Lösungen für LandwirtInnen bereitzustellen.