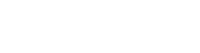Über den Zusammenhang von Psyche und Kunst

„Schöpferkraft und Wahnsinn liegen dicht beieinander.“ lautet ein Mythos, der so alt ist wie die Kunst selbst. Schon im antiken Rom existierte die Redewendung „Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.“ oder – wie es Friedrich Nietzsche Jahrtausende später in seinem berühmtesten Werk „Also sprach Zarathustra“ etwas weniger stigmatisierend formulierte: „Man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ Der ebenso sprachgewaltige wie tragische Philosoph ist einer von vielen historischen Berühmtheiten, begnadeten Musikern oder bahnbrechenden Schriftstellerinnen, die zu Lebzeiten in der einen oder anderen Weise unter einer psychischen Erkrankung litten. Dazu zählen – um nur einige zu nennen – beispielsweise auch Hölderlin, Robert Schumann und van Gogh. Letzterer zeichnete sich, obwohl er nur zehn Jahre lang malte, durch eine unglaubliche Produktivität aus. Bis zu seinem frühen Tod mit 37 Jahren brachte der niederländische Künstler mehr als 900 Gemälde und viele weitere Zeichnungen sowie Skizzen hervor.
Warum der Begründer der modernen Malerei, der sich selbst Teile seines linken Ohres abgeschnitten haben soll, durchschnittlich alle 36 Stunden ein neues Bild schuf und auf Hochtouren arbeitete, ist in einem seiner Briefe zu lesen: „Das tut mit gut und verjagt die abartigen Gedanken“, gestand er darin seinem Bruder Theo – Worte, die Analytiker von van Goghs Biografie als Schizophrenie interpretierten. Diese sei, schreibt Hermann Hesse, der mit Depressionen zu kämpfen hatte, in seinem Roman „Steppenwolf“, „der Anfang aller Phantasie“. Psychologen wie Sigmund Freud betrachteten diese Originalität als Restitutionsversuch innerhalb des Krankheitsgeschehens. Denn das bildnerische Schaffen gebe für einen wertvollen Moment Handlungsfreiheit zurück und sei ein wichtiges Ventil. So auch für Pablo Picasso, der seine depressive Verstimmung in der „Blauen Periode“ offenbarte, oder Edvard Munch, dessen Gemälde „Der Schrei“ von einer Panikattacke inspiriert wurde. Sein bekanntestes Motiv übt – wie die meisten Kunstwerke von Menschen mit psychischen Erkrankungen – eine besondere Magie aus, nimmt es doch mit in eine bizarre Erlebniswelt, die die Zerbrechlichkeit des menschlichen Gemüts sichtbar macht.
Die Neigung zu künstlerischer Betätigung, in der sich die eigenen Emotionen ausdrücken dürfen, tragen alle Menschen in sich, ganz gleich, ob sie im Laufe ihres Lebens psychisch erkranken oder nicht. Widerfahren kann dies grundsätzlich jeder und jedem von uns – statistisch, das fanden verschiedene internationale Studien heraus, kreativen oder forschenden Berufsgruppen sowie ihren Angehörigen jedoch tatsächlich etwas häufiger als dem Rest der Bevölkerung, der von Persönlichkeits-, Angst- oder Zwangsstörungen im Allgemeinen wenig weiß. Dieser fehlende Bezug sowie ein Mangel an Kontakt mit Erkrankten führt zu Furcht und Vorbehalten auf der einen sowie sozialer Isolation auf der anderen Seite. Lily Martin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, spricht in diesem Zusammenhang in Anlehnung an den Psychiater Asmus Finzen auch von einer „zweiten Krankheit“, die auf vielen Ebenen einschränkend wirkt – auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche und im Sozialen.
Gegen dieses gesellschaftliche Problem will sie zusammen mit Kerstin Schoch von der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg, vorgehen. Deshalb gründeten beide ein ortsunabhängiges und projektbasiertes Institut, das es sich zum Ziel gesetzt hat, das Stigma, welches psychische Erkrankungen begleitet, zu reduzieren. Zu diesem Zweck setzen sie künstlerische Medien und künstlerisch-therapeutische Methoden ein und machen so Erfahrungen der Betroffenen nachempfindbar. „Ästhetisches Erleben“, erläutert Martin den Ansatz des sogenannten Pop-up Instituts, „kann einen sinnlichen Zugang insbesondere dort begünstigen, wo sich etwas dem logischen Verstand sowie einer verbalen Erklärung entzieht, etwa im Fall von Psychosen, wie sie z. B. bei Schizophrenie durchlebt werden.“
Hierbei handelt es sich um eine der schwersten psychischen Erkrankungen, die das Denken und Fühlen massiv beeinflusst sowie mit Realitätsverlust, Trugwahrnehmungen und Wahnvorstellungen einhergeht. Die Wahrscheinlichkeit, zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens daran zu erkranken, liegt zwischen 0,5 und ein Prozent. In Deutschland sind rund 800.000 Männer und Frauen von Schizophrenie betroffen. Einer von ihnen ist Mathias. Für ihn ist entscheidend, dass die Menschen begreifen, dass seine Krankheit nichts mit dem zu tun hat, was beispielsweise die Medien suggerieren: „Schizophrenie ist nicht gleichzusetzen mit Unberechenbarkeit oder Gewalttätigkeit und hat auch nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun. Unter dem Begriff fasst man viel mehr eine recht heterogene Gruppe von psychischen Erkrankungen, die sich mit entsprechenden Therapien gut behandeln lassen und deren Symptome vielgestaltig sind.“
Um anderen zu ermöglichen, diese Lebenswirklichkeiten besser zu verstehen, hat das Pop-up Institut Betroffene wie Mathias, Kunst-Therapeuten sowie Künstlerinnen zusammengebracht. Gemeinsam haben sie in einem partizipativen Projekt mit Unterstützung der Volkswagen Stiftung ein intermediales Kunstfestival mit Workshops und Artist Talks auf die Beine gestellt, das in Berlin vom 11. bis 18. Juni 2022 interaktive Exponate sowie Performances zeigte. Darunter ein Audiowalk, der auf der Website des Instituts ausprobiert werden kann und der einen Eindruck davon vermittelt, wie es ist, Stimmen zu hören, die kein Gesicht haben. Um dieses für die meisten rational nur schwer nachzuvollziehende Erleben zu visualisieren, hat eine Performerin mit geschlossenen Augen und in Bewegung die Umrisse mehrerer Gesichter immer und immer wieder gezeichnet. „Über die Wiederholung ist nicht nur die Loslösung von körperlichen Gesichtsvorstellungen gelungen.“, schildert Lily Martin. „Im Rahmen des Festivals konnten auch Empathie gefördert und Vorurteile abgebaut werden. Vor allem der Audiowalk, der auf echten Psychose-Episoden der Beteiligten beruht, hat die Menschen bewegt – SchülerInnen, die noch keinerlei Berührungspunkte mit der Krankheit hatten, genauso wie Familienangehörige, die auf einem ganz anderen Level erfahren haben, was ihr Sohn oder ihre Tochter in akuten Phasen durchmachen“.