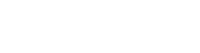Bilddenker besser verstehen

Bilddenker sind zwar überdurchschnittlich intelligent, haben jedoch eine ganz eigene Art, ihre Umgebung zu erleben: Sie verarbeiten alle Eindrücke ausschließlich in der rechten Gehirnhälfte. Deshalb ist ihre Wahrnehmung nicht analytisch, sondern bildhaft und kreativ. Dies erschwert es ihnen, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, weil sie etwa Buchstabenfolgen in Wörtern ebenso wie Zahlenreihen auf unterschiedlichste Weise kombinieren und lesen. Auch kreative Assoziationen sind möglich: Ein Kind erkennt zwar das Wort „Ferkel“, sagt aber „Schweinchen“. Die meisten bilddenkenden Kinder besuchen deshalb Förderschulen. „Bilddenkende Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in unserer Gesellschaft immer noch verkannt, weil ihre Stärke als vermeintliche Schwäche abgetan wird“, bedauert der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Dirk Randoll, der als Projektleiter für die Software AG – Stiftung tätig ist. „Die betroffenen Kinder könnten ganz anders gefördert werden, würde man ihre Art des Denkens und Wahrnehmens besser verstehen.“
Beim jüngsten SAGST-Projekt zu diesem Thema kooperierten auf Randolls Anregung hin zwei Projektpartner aus früheren Förderprojekten: Michael Harslem von der Akademie für Entwicklungsbegleitung sowie Prof. Dr. André Frank Zimpel und Dr. Alfred Röhm vom Fachbereich Sonder- und Heilpädagogik der Universität Hamburg. Michael Harslem hat 2006 bis 2012 das Lernforschungsprojekt „Freie Hofschule Gaisberg“ inhaltlich begleitet, bei dem bilddenkende Kinder auf einem Demeter-Bauernhof nahe Salzburg unterrichtet wurden (mehr dazu – auch zur Auswertung des Pilotprojekts durch die Alanus Hochschule – hier). An seine Forschung schließt aktuell eine breit angelegte Studie an, die die besonderen Wahrnehmungsmuster von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Dyskalkulie untersucht.
Durchgeführt wird sie an der Universität Hamburg, wo Alfred Röhm mit seiner Dissertation bereits 2016 erforscht hat, wie Kinder mit Trisomie 21 durch Bewegungslernen gefördert werden können (mehr dazu hier). Für die neue Studie untersuchten Zimpel und Röhm über 650 Kinder. „Ziel dabei war es, nicht nur Phänomene des Bilddenkens besser beschreiben zu können, sondern daraus auch gezielte pädagogische Förderungen abzuleiten“, erklärt der zuständige SAGST-Projektleiter Professor Randoll. „Letztlich ging es darum, ein diagnostisches Verfahren zu entwickeln, mit dem das Bilddenken von anderen Phänomenen wie etwa Lese- und Rechtschreibschwäche abgegrenzt werden kann.“ Besonders erfreulich sei deshalb, dass diese wichtige Arbeit auch nach Abschluss der Pilotstudie fortgesetzt wird. Für Oktober 2020 ist darüber hinaus ein großes Symposium an der Uni Hamburg geplant, bei dem sich Fachleute zum Thema austauschen werden.