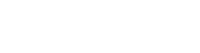Diversität und Resilienz: Forschungsprojekt zum biodynamischen Bananen-Anbau

Mit einem partizipativen Forschungsprojekt in der Dominikanischen Republik unterstützt die Software AG – Stiftung (SAGST) biodynamische Bananenbetriebe beim Aufbau widerstandsfähiger Produktionssysteme – ein wichtiger Beitrag für mehr ökologische, soziale und wirtschaftliche Resilienz in Zeiten des Klimawandels.
„Der Bananenanbau steht weltweit unter enormem Druck: Obwohl die Nachfrage in Europa weiter steigt, stagnieren die Erzeugerpreise für die Produzent*innen vor Ort – bei gleichzeitig steigenden Kosten.. Um dennoch wirtschaftlich rentabel arbeiten zu können, setzen auch ökologische Betriebe häufig auf große Monokulturplantagen. Diese gehen nicht nur zulasten der Artenvielfalt, hoher Nährstoffbedarf, Schädlingsdruck und Extremwetterereignisse stellen die Betriebe zusätzlich vor große Herausforderungen. Um hier neue Wege aufzuzeigen, fördert die SAGST die erste Phase eines neuen Praxisforschungsprojekts des Forschungsring e. V. Es will auf zehn Demeter-zertifizierten Bananenbetrieben in der Dominikanischen Republik die Basis für resilientere, nachhaltigere Anbausysteme im Sinne der biodynamischen Landwirtschaft legen.
„Es geht darum, bewährte Konzepte weiterzuentwickeln und konkret an die örtlichen Bedingungen anzupassen – mit innovativen Ideen, wissenschaftlicher Begleitung und vor allem im gegenseitigen Austausch“, erklärt Anna Elisabeth Bresser, Projektverantwortliche bei der SAGST. Dazu wurde ein partizipatives Netzwerk aus LandwirtInnen, BeraterInnen und Forschenden aufgebaut, die gemeinsam systemische Lösungsansätze erproben. In der ersten Phase reichen die Maßnahmen von der Einführung tiergestützter Weidesysteme mit Schafen über die Erhöhung der Stickstoffverfügbarkeit durch gezielten Anbau von Hülsenfrüchten bis hin zur Diversifizierung der Kulturen und der Verbesserung der Düngewirtschaft. Jeder Versuch wird auf mehreren Betrieben parallel oder zeitversetzt durchgeführt – so kann das Wissen wachsen und direkt in die Praxis zurückfließen.
Doch das Projekt will mehr als nur ökologische Fragen klären. Es adressiert auch die sozialen Herausforderungen der Region – etwa die hohe Migrationsrate und die schwierigen Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter. „Durch kollaboratives Lernen und konkrete Verbesserungen im Betriebsalltag können wir ein Umfeld schaffen, das für die Menschen vor Ort stärkend wirkt – auch in wirtschaftlicher Hinsicht“, so Bresser. „Wir sehen hier eine Möglichkeit, dass aus dem gemeinsamen Forschen echte Bindung, Verantwortung und ein neues Verständnis für biodynamisches Arbeiten entstehen kann.“