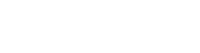„Leben ist Wandel und permanente Entwicklung“

Die Jugendhilfeeinrichtung Mäander in Potsdam schafft seit 2013 einen geschützten Raum für Jugendliche, die unter psychischen Erkrankungen leiden oder schwere Krisenzeiten durchleben müssen. Mit Unterstützung lernen sie hier, selbständig die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Die therapeutische Wohngemeinschaft setzt dabei auf Gemeinschaftserleben, Tagesstruktur und sinnvolle Arbeit in Haus, Garten oder Werkstatt. Von den Anfängen, Zielen und Herausforderungen der Jugendhilfeeinrichtung berichtet Sebastian Sieboldt im Interview.
Was war die Initialzündung für Mäander?
Sieboldt: Der Impuls kam aus dem Mitarbeiterkreis am Krankenhaus Havelhöhe. Meine Kollegen und ich haben dort beobachtet, dass viele Patienten oft große Probleme damit hatten, sich eine eigene Tagesstruktur aufzubauen, wenn sie im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt in therapeutische Wohngemeinschaften entlassen wurden.
Wie geht Mäander mit diesen Schwierigkeiten um?
Sieboldt: Auch unsere Bewohner haben natürlich starke innere Widerstände, bestimmte Sachen zu tun oder Abläufe einzuhalten. Das führt zum Teil zu großen Problemen im Alltag, besonders im Zusammenleben mit anderen. In der Wohngemeinschaft äußert sich das beispielsweise in der Weigerung, die anfallenden Arbeiten zu erledigen. In solchen Situationen gehen wir in die Konfrontation und arbeiten mit den Jugendlichen an diesen Widerständen, damit sie verstehen, woher diese kommen und wie sie entstehen. Konkret versuchen wir, die Jugendlichen ins Tun zu bringen. Unser Ziel ist es, dass sie sich wieder auf einen strukturierten Tagesablauf einlassen und lernen, dass es sich lohnt, einer sinnvollen Arbeit in Garten oder Werkstatt nachzugehen und sich so für die Gruppe einzusetzen.
Das Ziel der Therapie ist es also, dass die Jugendlichen aktiv werden?
Sieboldt: Zunächst liegt der Fokus auf der Strukturfähigkeit. Sie ermöglicht es den Bewohner nach ihrer Zeit bei Mäander, sich im alltäglichen Leben zurechtzufinden und sich selbst zu versorgen. A und O für uns ist aber vor allem die Beziehungsarbeit. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir mit den Jugendlichen überhaupt in die Konfrontation gehen und die Widerstände bearbeiten können. Strenge kann nämlich nur funktionieren, wenn vorher eine enge Beziehung vorhanden ist.
Wie schaffen Sie es, diese Beziehung aufzubauen?
Sieboldt: Durch das Füreinander-da-Sein – sowohl zwischen den Mitarbeitern und den Bewohnern als auch innerhalb der Gruppe. Auf ihre Gemeinschaft kommt es ganz besonders an. Oft hat es eine viel stärkere Wirkung, wenn nicht wir als Betreuerinnen und Betreuer sagen, dass ein bestimmtes Verhalten nicht gut ist, sondern ein solcher Hinweis von den Mitbewohnern kommt. Diese Begegnung innerhalb der Gruppe aufzubauen ist nicht immer einfach, aber sehr wichtig.
Warum?
Sieboldt: Die Jugendlichen, die zu Mäander kommen, haben großes Leid erfahren und sind bindungstraumatisiert. Ihre negativen Erfahrungen haben dazu geführt, dass sie – mit allem Recht –
sehr stark Ich-bezogen agieren und erst wieder lernen müssen, Bindungen und Beziehungen aufzubauen.
Werden dabei auch die Familien eingebunden?
Sieboldt:Wir tauschen uns gerade in den ersten Wochen intensiv mit den Eltern aus, um den Loslösungsprozess zu begleiten und ihnen nicht das Gefühl zu geben, ihr Kind zu verlieren. Eine enge und wohlwollende Kommunikation mit der Familie ist uns dabei sehr wichtig, denn wir sind zwar eine Art „Ersatzfamilie“, aber eben nicht mehr. Auf Dauer können wir nie das bieten, was eine richtige Familie – so ungünstig die familiären Verhältnisse auch sein mögen – geben kann. Daher ist es ganz wichtig, egal, mit welchen Problemen oder Erkrankungen die Jugendlichen zu Mäander kommen, eine Art Erziehungspartnerschaft mit den Eltern einzugehen.
Können Sie ein Beispiel für die Situationen oder Krankheitsbilder nennen, mit denen die Jugendlichen zu Mäander kommen?
Sieboldt:Wir haben eine sehr heterogene Bewohnerschaft im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Einige kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, andere haben aufgrund einer Schizophrenie den Weg zu Mäander gefunden. Wieder andere leiden am Borderline-Syndrom oder an posttraumatischen Belastungsstörungen, die häufig auf schlimme Vernachlässigung oder Missbrauch zurückgeführt werden können.
Gibt es auch Fälle, in denen Sie die Aufnahme ablehnen müssen?
Sieboldt: Fremdaggressives Verhalten oder Drogensucht sind solche K.o.-Kriterien. Wir haben viele junge Menschen, die traumatisiert und hochsensibel sind. Wenn sie hier auf eine Person treffen würden, die extreme Aggressivität ausstrahlt, können sie ihr nichts entgegensetzen. Ebenso sind wir keine Drogenhilfeeinrichtung. Wenn Drogen bei den Patienten ein Thema sind, führt das nicht unbedingt zum Ausschluss, wenn sie aber im Mittelpunkt stehen schon, weil massive Drogenabhängigkeit ganz klar ein anderes Setting braucht, als wir es hier haben.
Was ist das Besondere an Mäander?
Sieboldt:Wir wollen den Jugendlichen klar machen, dass Leben Wandel ist und eine ständige Entwicklung bedeutet. Vor diesem Hintergrund versuchen wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern das Gefühl zu nehmen, sie seien Verlierer und würden vom Schicksal ungerecht behandelt. Mit viel Empathie möchten wir ihnen stattdessen zeigen, dass sie, wenn sie ihr Leben annehmen und ihren Weg gehen, am Ende viel mehr erreichen können. Das ist Mäander-typisch.
Wie erleben Sie den Zeitpunkt, wenn die Bewohner das Projekt verlassen?
Sieboldt: Das ist immer ein spannender Prozess für alle. Im Schnitt bleiben die Bewohner zwei Jahre bei uns, wobei uns einige Bewohner auch erst zu einem späteren Zeitpunkt verlassen. Der Impuls, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, kommt dabei interessanterweise eindeutig von den Jugendlichen selbst. So gab es auch schon Fälle, in denen wir nicht sicher waren, ob der Bewohner schon stabil genug für diesen nächsten Schritt ist. Daher ist es uns wichtig, dass wir den Kontakt auch nach der Zeit bei Mäander halten. Wenn wir wieder von einander hören, spüren wir, dass der Aufenthalt bei uns eine gute und wichtige Zeit für unsere ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner war, die sie weitergebracht hat.