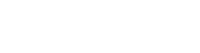Nachgefragt: Wie Menschen mit Trisomie 21 leichter (rechnen) lernen und was sie uns beibringen können

Lange Zeit war man davon überzeugt, dass es sich bei Trisomie 21 um eine Erbkrankheit handelt. Erst relativ spät – in den 1960er Jahren – entdeckte der französische Genetiker Jérôme Lejeune, dass die Verdreifachung des 21. Chromosoms eine spontane Mutation der Gene ist. Seitdem wurden etliche Forschungsgelder investiert, um diesen sogenannten Gendefekt zu eliminieren. Prof. Dr. André Frank Zimpel von der Universität Hamburg und sein Doktorand Torben Rieckmann hingegen gehen ganz anderen Frage nach: Sie wollen herausfinden, wie sich die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft für Menschen mit Trisomie 21 verbessern lassen. Im Interview sprachen die Erziehungswissenschaftler u.a. über ihre aktuelle Forschung, die Bedeutung von Mathematik für ein selbstbestimmtes Lebens und die Rolle, die eine Tablet-App namens Mathildr (Aussprache: „Mathilda“) dabei spielen kann.
Ihr Promotionsvorhaben, das durch die Software AG – Stiftung unterstützt wird, trägt den Titel „Verbesserung des mathematischen Lernerfolgs von Menschen mit Trisomie 21“. Auf welche wissenschaftlichen Fragestellung wollen Sie dabei Antworten geben und wie gehen Sie methodisch vor?
Rieckmann: Wir haben in einer Studie herausgefunden, dass Menschen mit Trisomie 21 einen Aufmerksamkeitsumfang von zwei Einheiten haben. Anders als Menschen ohne Trisomie 21, die in der Regel in einer Viertelsekunde vier wahrgenommene Einheiten aus ihrer Umwelt gleichzeitig bewusst wahrnehmen und verarbeiten können. In meinem Forschungsprojekt geht es deshalb um die Frage, wie Mathematikunterricht für Menschen mit einem verringerten Aufmerksamkeitsumfang aussehen kann. Dazu entwickle ich gemeinsam mit Menschen mit Trisomie 21 Unterrichtsmaterialien, die anschließend wissenschaftlich erprobt und ausgewertet werden.
Zimpel: Die Hypothese lautet, dass Menschen mit Trisomie 21 besser rechnen könnten, wenn ihnen die Gesellschaft entgegen käme. Da sie das nicht tut, haben die meisten von ihnen mit Mathematikproblemen zu kämpfen. In anderen gesellschaftlichen Bereichen, in denen ein sogenannter Nachteilsausgleich gelingt, finden wir stets barrierefreie Bedingungen vor: Wir wissen, dass einem blinden Menschen Leitsysteme und Blindenschrift helfen. Wenn ein Mensch gehörlos ist, benötigen wir Gebärden-Dolmetscher und -Dolmetscherinnen. Wir wollen den entscheidenden Punkt finden, der es Menschen mit Trisomie 21 ermöglicht, barrierefrei mathematische Inhalte zu erlernen. Wenn uns das gelingt, können wir auch Schlussfolgerungen für andere gesellschaftliche Bereiche ziehen, damit auch Menschen mit Trisomie 21 ein selbstbestimmtes Leben voller Teilhabe führen können.
DURCH LERNERFOLGE ZU EINEM SELBSTBESTIMMTEN LEBEN
Was bedeutet die Fähigkeit rechnen zu können, für ein selbstbestimmtes Leben?
Rieckmann: Diese Fähigkeit ist sehr wichtig. Die Inklusionsaktivistin Andrea Halder hat uns beispielsweise gezeigt, dass die Fähigkeit im Umgang mit Zahlen die Würde des alltäglichen Lebens maßgeblich beeinflusst. Sie hat einmal in einem Literaturcafé als Kellnerin gearbeitet und musste feststellen, dass sie zwar die Bestellungen aufnehmen und servieren durfte, die Abrechnung aber ihre Kolleginnen und Kollegen für sie übernommen haben. Damit ist ihr nicht nur das Trinkgeld entgangen, sondern auch die Anerkennung, die sie sich gewünscht hat.
Was hat Sie speziell zu Ihrem Promotionsvorhaben motiviert und was leitet Sie bei Ihrer Arbeit?
Rieckmann: Zunächst empfinde ich die Situation an den Schulen als ungerecht. Schülerinnen und Schüler mit Trisomie 21 sollen in der Regel mit den gleichen Unterrichtsmaterialien und Methoden arbeiten, wie ihre Mitschüler ohne Trisomie 21. Meistens sind die Materialien kleinschrittiger aufbereitet und größer abgebildet. Es wird aber nicht berücksichtigt, dass der Aufmerksamkeitsumfang der Schülerinnen und Schüler mit Trisomie 21 geringer ist als der der übrigen Kinder.
Zimpel: An dieser Stelle zeigt sich das Paradoxon, mit dem Menschen mit Trisomie 21 oft konfrontiert werden, nämlich die Vereinfachung verschiedener Prozesse. Sicherlich kann einfache Sprache dabei helfen, komplexe Texte leichter zu verstehen. Was dabei jedoch übersehen wird, ist, dass Menschen mit Trisomie 21 aufgrund ihres geringeren Aufmerksamkeitsumfangs vor allem von Abstraktionen profitieren. Die scheinbare Vereinfachung der Welt bedeutet für sie oft, die Dinge noch unverständlicher zu machen. Wir glauben deshalb nicht, dass mit einfacher Sprache das Wichtigste für die Inklusion getan ist, sondern die Arbeit erst anfängt.
Rieckmann: Zudem haben wir im Laufe der Trisomie-21-Studie eine Beratungsstelle an der Universität gegründet, da uns immer mehr Anfragen von Eltern von Kindern mit Trisomie 21 erreichen, die gerne mit uns zusammen arbeiten möchten. Ich habe schon mit sehr vielen Kindern mit Trisomie 21 individuellen Mathematikunterricht durchgeführt und festgestellt, dass sie sehr wohl Lernerfolge feiern können. Ich möchte diese Erfolge gerne wissenschaftlich nachvollziehen und die Methoden so aufbereiten, dass sie für andere Menschen zugänglich werden.
EINE APP – VON MENSCHEN MIT TRISOMIE 21 FÜR MENSCHEN MIT TRISOMIE 21
Wurden Sie so vom Wissenschaftler zum App-Entwickler?
Rieckmann: Ich habe zunächst ein System entwickelt, in dem nach einem bestimmten Schema Punkte angeordnet werden. Dieses Schema habe ich erst auf Pappe dargestellt, später kamen einige Prototypen aus Holz dazu. Eine Tablet-App hat sich deshalb bewährt, weil sich so Mengenbilder flexibel darstellen lassen und verschiedene Hinweise eingeblendet werden können. Wir haben in unserer Studie zudem festgestellt, dass es Menschen mit Trisomie 21 leichter fällt, Wisch- oder Touch-Gesten durchzuführen, als etwas zu schreiben oder zu malen. Ein weiterer Vorteil der App ist, dass sie sehr einfach weitergegeben werden kann. Um mit dem Unterrichtsmaterial arbeiten zu können, muss es nur aus einem der verschiedenen App-Stores heruntergeladen werden.
Zimpel: Wir haben bei unserer Untersuchung gesehen, dass Personen mit Trisomie 21 Problemaufgaben in Zweierbündeln sortieren. Diese Idee wird in der App aufgegriffen und durch Kirschpaare verdeutlicht. Es ist also nicht nur eine Methode, die für diese Menschen entwickelt wurde, sondern auch eine Methode, die von ihnen mitentwickelt wurde. Das finde ich sehr wichtig. Letztlich haben die Beobachtungen, die im Dialog mit den Menschen entstanden sind, zu der App geführt. Man könnte sagen, die ersten Entwickler unserer App waren die Menschen mit Trisomie 21 und Torben Rieckmann hat sie weiterentwickelt.
SPIELERISCHES LERNEN MIT MATHILDR
Spielt also auch das spielerische Lernen bei der App und der Forschung eine Rolle?
Rieckmann: Das spielerische Lernen sollte grundsätzlich eine Rolle spielen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass tatsächlich im Spiel eine Förderung stattfindet, wenn man das individuelle Verhalten des Kindes beachtet. Man kann die Spieltheorie von Zimpel als Handwerkszeug bezeichnen, mit dem man als Pädagogin oder Pädagoge wirklich hervorragend arbeiten kann. Im Idealfall empfinden die Kinder den Unterricht dann auch nicht als „Lernen“ oder „Büffeln“.
Zimpel: Eine Erkenntnis der Montessori- sowie der Waldorf-Pädagogik lautet, dass ein Lerninhalt, der zu früh oder zu spät angeboten wird, seine Wirkung verfehlt. Deshalb ist uns diese Spieltheorie so wichtig, weil wir damit genau bestimmen können, wann wir welche Lerninhalte anbieten. Die Kinder sollen weder überfordert, noch unterfordert werden. Wenn man genau den richtigen Zeitpunkt trifft, wird man feststellen, dass man mit der Kraft der Begeisterung der Lernenden arbeitet.
Wie muss man sich das Arbeiten mit der App vorstellen? Gibt es Rechenaufgaben, die gelöst werden müssen?
Rieckmann: Der erste Schritt ist darüber zu sprechen, wie die Mengenbilder aussehen. Die Zahl Fünf kann beispielsweise von den Lernenden mit Trisomie 21 als „Paar, Paar, Kirsche“ verbalisiert werden. Die Darstellung des Kirschpaars entspricht dabei dem Aufmerksamkeitsumfang von zwei. Wenn die Mengenbilder bekannt sind, ist der nächste Schritt Rechenaufgaben durchzuführen. Eine von vielen Möglichkeiten wäre zum Beispiel: Es werden zunächst vier rote Kirschen angezeigt und dann kommen zwei gelbe Kirschen hinzu. Das Ziel ist, dass die Kinder nicht nachzählen müssen, sondern sehen, dass sie bereits zwei Paar Kirschen haben, ein weiteres Paar hinzukommt und es am Ende drei Paare, also sechs Kirschen sind.
WAS WIR VON KINDERN MIT TRISOMIE 21 LERNEN KÖNNEN
Was können wir umgekehrt von Kindern mit Trisomie 21 lernen?
Zimpel: Wir können vor allem lernen, dass Intelligenz nicht angeboren ist. Intelligenz hängt zum einen von intrinsischer Motivation ab. Menschen mit Trisomie 21 haben schlechte Voraussetzungen für das Lernen aber ihre intrinsische Motivation erhalten viele aufrecht, einige wenige schafften schon Universitätsabschlüsse. Ich finde das unglaublich motivierend. Zum anderen ist Intelligenz von Vertrauen abhängig. Wenn ein Mensch kein Vertrauen in seine Umwelt hat und nicht daran glaubt, dass seine Leistungen und Schwierigkeiten anerkannt sowie respektiert werden, kann er sich nicht entwickeln.