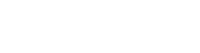Nicht deklariert und doch nachweisbar: Dr. Uwe Geier über den Einsatz von Röntgenstrahlen in der Lebensmittelkontrolle

Die Produktionskette industriell verarbeiteter Lebensmittel ist mitunter lang und damit für den Verbraucher oftmals ziemlich undurchsichtig. Nur die wenigsten dürften wissen, dass verpackte Lebensmittel zur Qualitätskontrolle häufig einer Röntgenuntersuchung unterzogen werden. Denn Produzenten und Handel müssen nicht explizit darauf hinweisen. Möglicherweise zu Unrecht, wie Dr. Uwe Geier im Interview herausstellt. Als wissenschaftlicher Leiter der Wirksensorik GmbH und Geschäftsführer des Forschungsring e.V. hat er untersucht, ob sich trotz der niedrigen Strahlenmenge, die bei solchen Produktinspektionen zum Einsatz kommt, Veränderungen an den geröntgten Lebensmitteln feststellen lassen.
Als Wissenschaftler widmen Sie sich bereits seit vielen Jahren Nahrungsmitteln und ihrer spezifischen Wirkungsweise auf den Menschen. Wie kam es zu Ihrer Forschung auf dem Gebiet der Röntgenstrahlung?
Durch die Zusammenarbeit mit Herstellern biologisch und bio-dynamisch erzeugter Lebensmittel bin ich erstmals 2012 mit dem Thema in Kontakt gekommen. Obwohl ich als Lebensmittelfachmann schon eine Zeit lang in diesem Bereich gearbeitet habe, war mir zu diesem Zeitpunkt völlig fremd, das bestimmte Lebensmittel zu Mess- und Prüfzwecken geröntgt werden. Die Tatsache, dass man die Kunden hierüber nicht informiert, weil es keine entsprechende Deklarationspflicht gibt, war im Grunde der Impuls für meine nachfolgende Forschung.
Was sind die Hintergründe für die Anwendung dieser Methode?
Es geht darum, Verbraucher vor Fremdkörpern wie Steinen oder Glassplittern zu schützen. Geröntgt werden deshalb üblicherweise verpackte Lebensmittel wie Obst- und Gemüse-Konserven, Brot oder auch Milchprodukte. Während ein solches Vorgehen vor allem bei besonders sensiblen Produkten wie Babynahrung im Glas noch einleuchtet, gibt es aber auch Anwendungsbereiche, bei denen man die Notwendigkeit des Röntgens durchaus in Frage stellen darf. Beispielsweise dann, wenn Röntgenstrahlung eingesetzt wird, um die Füllhöhe in einer Verpackung zu bestimmen.
Wie stark muss man sich diese Röntgenstrahlung vorstellen, die beim Durchleuchten der Lebensmittel zum Einsatz kommt?
Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 500 Milligray. Nach Auskunft der Lebensmittelhersteller setzen sie nur einen Bruchteil davon tatsächlich ein – etwa ein Fünfhundertstel oder ein Fünftausendstel. Das entspricht ungefähr der Belastung bei einer Röntgenaufnahme des Kopfes und ist damit relativ gering. Dennoch wissen wir durch verschiedene medizinische Studien, dass ungeborenes Leben vor Röntgenstrahlung unbedingt geschützt werden muss und häufiges Röntgen vermieden werden sollte, weil dieses selbst bei niedriger Strahlenbelastung die Tumorgefahr erhöhen kann.
Wie weit verbreitet ist diese Technologie?
Insgesamt ist das Röntgen verpackter Lebensmittel vermutlich weit verbreitet, nur gibt es bislang keinerlei Transparenz darüber, welche Firmen die Technik konkret nutzen. Allerdings wird sie sicher vor allem bei mittleren und großen Hersteller zum Einsatz kommen, denn diese Technologie ist teuer. Deshalb setzen kleine handwerkliche Betriebe sie gar nicht ein. Auch kann man davon ausgehen, dass Hersteller konventionell erzeugter Lebensmittel häufiger mit dieser Methode arbeiten als Unternehmen der Bio-Branche. Das Alarmierende dabei: Röntgenstrahlung kann Lebendiges verändern. Generell führt jede Röntgenuntersuchung zu Schäden am Erbgut. Es kommt zu sogenannte DNA-Brüche, die der Körper jedoch wieder repariert. Doch was geschieht mit Lebensmitteln, wenn man sie bestrahlt? Die grundlegende Frage, die man in diesem Zusammenhang zunächst beantworten muss, lautet: Sind Lebensmittel lebendig? Heißt die Antwort „Nein“, wird sich das Produkt wohl kaum verändern – weder chemisch, noch strukturell. Bei einem „Ja“ braucht es aber geeignete Verfahren, um Lebendiges bzw. Veränderungen dran wahrzunehmen.
Welche sind das?
Man weiß, dass alles Lebendige eine gewisse, wenn auch nur schwache Lichtstrahlung besitzt. Deshalb haben wir zum Beispiel auf die sogenannte Fluoreszenz-Anregungsspektroskopie zurückgegriffen, die die Rückstrahlung von Lebensmitteln messen kann. Wir haben aber auch ganz klassische Keimtests vorgenommen, die unter anderem in der Pflanzenzüchtung zum Einsatz kommen. Außerdem haben wir mit der Kupferchlorid-Kristallisation sogenannte bildgebende Verfahren eingesetzt. Dabei entsteht ein Bild, indem man einen flüssigen Auszug des Produktes zusammen mit Kupferchlorid in einer Glasplatte unter kontrollierten Bedingungen auskristallisieren lässt. Dieser Vorgang ist sehr sensibel, sodass man Störungen in der Probe sehr gut feststellen kann. Auch Algentests reagieren sehr empfindlich. Das ist nur ein kleiner Einblick in die große Bandbreite an Tests, die wir durchgeführt haben. Auch die Wirk-Sensorik haben wir als Methode angewandt. Das wichtigste Messinstrument dabei ist der Mensch. Er kann, wenn er achtsam darauf schaut, wie das Lebensmittel auf ihn wirkt, möglicherweise direkt Effekte wahrnehmen.
Außerdem, und das finde ich persönlich ganz spannend, haben wir eine chemische Methode mit dem Namen Alkylcyclobutanone 2ACB eingesetzt. Sie ist deshalb so interessant, weil sie standardmäßig angewandt wird, um Bestrahlung nachzuweisen, allerdings bisher nicht in diesem niedrigen Bereich. Unser Projektpartner hat die Methode verfeinert, und tatsächlich sogar diesen Grenzwert erreicht. Das ist ein tolles Ergebnis, denn im Gegensatz zu den anderen Methoden, die nicht vollumfänglich von allen Wissenschaftlern akzeptiert werden, handelt es sich hierbei um ein anerkanntes Verfahren nach europäischen Normen.
Was waren für Sie die eindrücklichsten Untersuchungsergebnisse?
Im Anschluss an die versuchsmäßige Bestrahlung von Gänseschmalz ließ sich eine messbare Veränderung nachweisen. Die Bestrahlung hatte bestimmte schädliche Substanzen produziert, die vorher nicht im Produkt waren. Auch der wirksensorische Test, an dem 60 Konsumentinnen und Konsumenten teilgenommen haben, hat ergeben, dass bestrahltes Wasser geschmacklich als weniger frisch empfunden wird – und das, obwohl hier in einem sehr niedrigen Bereich von 1 Milligray bestrahlt wurde. Auch durch die bildgebenden Verfahren konnten in sieben Probenpaaren aus Obst und Gemüse-Konserven von drei Bio-Herstellern verblüffende Unterschiede zwischen den bestrahlten und nicht-bestrahlten Produkten in Form von stärkeren Alterungserscheinungen festgestellt werden.
Gibt es Alternativen zum Einsatz von Röntgenstrahlen zur Qualitätskontrolle bei Lebensmitteln?
Durch gemeinsame Workshops mit Produzenten von Lebensmitteln weiß ich, dass manche von ihnen sehr beeindruckt waren, nachdem sie erleben konnten, dass das Röntgen tatsächlich einen Effekt auf ihre Produkte hat. Insofern denke ich, dass diese Hersteller jetzt sorgsamer mit der Thematik umgehen und auch kritisch hinterfragen, an welchen Stellen das Durchleuchten von Lebensmitteln wirklich notwendig ist. Man kann nämlich mit den üblichen Methoden wie Probenentnahmen bei der Fertigung, also durch menschlichen Einsatz und gute Praxis, bereits eine sehr hohe Sicherheit gewährleisten und Risiken minimieren. Natürlich kann auch versucht werden, zusätzliche technische Geräte in der Endkontrolle einzusetzen. Ob es hier zu einem Umdenken kommt, hängt jedoch weniger nur von den Herstellern, sondern primär auch vom Handel ab, der keine Reklamationen und Rückrufe, sondern absolute Sicherheit will. Insofern stellt er hohe Anforderungen an die Produzenten von Lebensmitteln und verlangt den Einsatz modernster Technologien – z. T. unabhängig davon, ob ihr Einsatz Sinn macht oder nicht. Es gibt sogar Hersteller, die ihre in Tüten verpackten Produkte zwei- oder dreimal röntgen. Und das nur, um gegenüber der abnehmenden Hand eine höhere Produktsicherheit zu dokumentieren. An dieser Stelle würde ich mir zum einen ein bewussteres Abwägen durch die Produzenten wünschen und zum anderen eine bessere Aufklärung der Verbraucher, damit diese selbst entscheiden können, was sie konsumieren und was nicht. Vor diesem Hintergrund wäre es richtungsweisend, wenn es Händler gäbe, die ausloben würden, dass ihre Produkte nicht einer Röntgeninspektion unterzogen werden.