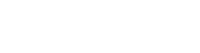Saatgut: Die Qualität des Lebendigen

Saatgut ist weltweit die Grundlage für die Ernährung der Menschen und Nutztiere und damit ein Thema, das alle betrifft. Es ist gleichzeitig ein Kulturgut und ein Wirtschaftsfaktor. Sebastian Bauer und Klaus Plischke, die bei der Software AG – Stiftung Projekte im Bereich Saatgut-Forschung- und Züchtung betreuen, erläutern im Gespräch die vielfältigen Aspekte dieses komplexen Themas. Weiterführende Informationen, Artikel und Studien finden sich unter www.saatgutfonds.de.
Eine kürzlich erschienene Anzeige der SAGST hat den Titel „Unfruchtbares Saatgut – eine gute Geschäftsidee?“. Was zunächst widersprüchlich klingt – immerhin ist Saatgut ein Symbol für Fruchtbarkeit – scheint weitgehend Normalität zu sein. Was sind die Hintergründe?
Sebastian Bauer: Früher war es so, dass der Bauer einen Teil seiner Ernte zurückhielt, um das gewonnene Saatgut im nächsten Jahr wieder auszusäen. Dies wird in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern bis heute so betrieben, idealerweise auch in der ökologischen Landwirtschaft. In den letzten Jahrzenten hat sich im konventionellen Bereich allerdings eine neue Züchtungsmethode entwickelt und durchgesetzt – die Hybridzüchtung. Dabei geht es darum, dass bestimmte Merkmale einer Pflanze in einer Art Verengungsprozess auf einer Zuchtlinie vereint werden. Diese Engführung funktioniert mittels Inzucht. Der Clou daran ist, dass die erste Generation überdurchschnittlich gute Ergebnisse liefert, z. B. im Ertrag, aber das aus der Ernte gewonnene Saatgut nicht wieder ausgesät werden kann, weil es teilweise seine Fruchtbarkeit und die Homogenität verliert. Hierbei handelt es sich noch im gewissen Maße um eine „normale“ Züchtungsmethodik. Die Züchtung mittels gentechnischer Verfahren und die daraus folgende Patentierung von Eigenschaften, lässt dann überhaupt keinen eigenen Nachbau mehr zu.
Klaus Plischke: Im Grunde wurde das Saatgut dadurch mit einer Art biologischem Kopierschutz ausgestattet, was zu extremen Auswüchsen und Monokulturen geführt hat. Landwirte und Gärtner können das Saatgut vielfach nicht mehr selbst vermehren, sondern müssen es jedes Jahr wieder neu kaufen und geraten damit immer stärker in eine Abhängigkeit von wenigen global agierenden Chemie-Konzernen, die Dreiviertel des weltweiten Saatgut-Marktes untereinander aufteilen. Im Hintergrund steht hier eine gnadenlose Geschäftsidee.
Bauer: In der Tat, es geht hierbei um die Kommerzialisierung der Züchtung. Gleichzeitig gedeihen diese Sorten nur mit den Dünge- und Spritzmitteln, welche von den gleichen Chemiekonzernen angeboten werden. Damit wird die Abhängigkeit noch verstärkt. Der nächste Schritt war und ist das Züchten von Pflanzen durch gentechnische Verfahren, die dann selbst Pestizide produzieren um Schädlinge abzuwehren; dies geschieht jedoch ohne die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt abschätzen zu können.
Aber Bedarf es zur Welternährung nicht einer Hochleistungs-Landwirtschaft, die sich aller technischen Möglichkeiten bedient, also auch der Gentechnik? Anders gefragt: kann mit ökologischer, ressourcenschonender Landwirtschaft, die auf Sortenvielfalt und samenfeste Sorten setzt, die Welternährung sichergestellt werden?
Plischke: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf lange Sicht nur mit einer ökologischen, ressourcenschonenden Landwirtschaft die Welternährung sicherstellen können. Kurzfristig kann mit einer Hochleistungslandwirtschaft sicherlich mehr Ertrag pro Hektar generiert werden, d.h. ökologische Landwirtschaft benötigt zunächst einmal mehr Fläche. Wobei dies nicht überall gilt, in Entwicklungsländern sind die Erträge der bäuerlichen Landwirtschaft beispielsweise deutlich höher als in der technisierten Landwirtschaft, die dort vor allem auf Monokulturen setzt. Weltweit betrachtet ist die Ökolandwirtschaft also sogar effektiver. Man muss auch die vielen „Kollateralschäden“ einer Hochleistungslandwirtschaft einpreisen. Da gibt es direkte Schäden wie beispielsweise Grundwasserverschmutzung durch Überdüngung und Chemikalieneinsatz. Indirekte Schäden wie eine Zunahme von Allergien und die Abnahme der Lebensmittelqualität sind schwerer nachzuvollziehen oder zu belegen. Neben Schäden gibt es auch durchaus eine ethische und eine erschütternde soziale Komponente. Gerade in Indien sind die sozialen Verwerfungen bedingt durch die extreme Abhängigkeit von dem gentechnisch veränderten Saatgut einschließlich der teuren Spritzmittel sehr deutlich sichtbar; tausende von kleinen Landwirten begingen Selbstmord, da sie ihre Familien nicht mehr ernähren konnten und sie von hohen Schulden erdrückt wurden.
Bauer: Dieses Bild wird auch vom Weltagrarbericht 2008 bestätigt, der mit dem Mythos der Überlegenheit industrieller Landwirtschaft aus volkswirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht gründlich aufräumt. Der von der Weltbank und der UN initiierte und von 59 Ländern angenommene Bericht fordert einen radikalen Kurswechsel in der Landwirtschaft, weg von der industriellen Massenproduktion, hin zur ökologischen Landwirtschaft. Kleinbäuerliche Strukturen, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika sind demnach die wichtigsten Garanten für die nachhaltige Lebensmittelversorgung einer wachsenden Weltbevölkerung. Der alternative Nobelpreis 2013 für den Co-Präsidenten des Weltagrarberichtes Hans Herren zeigt die Wichtigkeit und Brisanz des Themas.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Biodiversität, brauchen wir wirklich tausende Saatgut-Sorten?
Bauer: Mit der Industrialisierung der Lanwirtschaft und der Kommerzialisierung der Saatgutforschung und -Züchtung hängt zusammen, dass Unternehmen ihre Sorten gewinnbringend in den Markt bringen wollen – das führt dazu, dass andere Sorten in der Züchtungsbearbeitung vernachlässigt wurden und damit für kommerzielle Saatzuchtunternehmen uninteressant geworden sind.
Plischke: Und diese Vielfalt in Form von tausenden von Saatgutsorten einerseits und Saatgut mit einer breiten oder vielfältigen Genetik andererseits ist wiederum unabdingbar als Grundlage für die Züchtungsarbeit. Denn jede Sorte vereint andere Eigenschaften, sei es die Resistenz gegen bestimmte Schädlinge, die Anpassung an geographische Gegebenheiten oder geschmackliche Besonderheiten.
Bauer: Nur aus der Vielfalt der Sorten heraus können immer wieder neue Anpassungen erfolgen, z.B. an Klimaveränderungen. Diese Eigenschaften gehen verloren, wenn ich sie nicht mehr kultiviere, und ich kann sie nicht mehr in moderne Sorten einkreuzen.
Das heißt, Bio ist nicht gleich Bio und die Frage nach dem Saatgut ist für den Ökolandbau von noch höherer Relevanz als für den konventionellen?
Plischke: Das ist ein gravierendes Problem, denn beispielsweise in der Gemüsezüchtung gibt es für manche Sorten wie z.B. Blumenkohl oder Broccoli kaum noch samenfestes, also nachbaubares Saatgut, sondern nur noch Hybrid- oder CMS-Sorten. Während Hybridsorten im Ökolandbau teilweise eingesetzt werden dürfen, wird die CMS-Technik abgelehnt. Denn diese Technik ist Genmanipulation, also Gentechnik. Das halten wir auch als Stiftung für ethisch fragwürdig, denn man greift damit in die Naturgrundlagen ein, ohne wirklich alle Konsequenzen zu kennen. Der Ansporn ist eine Geschäftsidee im negativen Sinn. Ziel ist der maximale Profit und nicht die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln für die Menschheit.
Bauer: Ein weiteres Problem ist, dass für den ökologischen Landbau die hochgezüchteten konventionellen Sorten oft nicht mehr verwendbar sind, es liegen keine natürlichen Resistenzen mehr vor, die Pflanzen müssen beispielsweise durch Pestizide und Fungizide (und Schwermetalle bei der Beizung) behandelt werden. Neben diesen anbautechnischen Gründen gibt es noch einen ganz anderen Aspekt: Die Lebensmittelqualität. Alleine wenn wir auf den Geschmack schauen, dann hat das in der konventionellen Züchtung bisher kaum eine Rolle gespielt. Hier kommen wir an einen Punkt, bei dem es nicht darum geht, was das Negative an der konventionellen Züchtung, sondern was das Positive, das Einzigartige der ökologischen und insbesondere der biodynamischen Züchtung ist. Denn da geht es nicht nur um das Stoffliche, um das Nahrungsmittel, sondern um das Lebendige, das Lebensmittel im eigentlichen Sinne. Also darum, welche Lebenskraft den Menschen durch den Genuss der Lebensmittel zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist es, den Menschen optimal zu unterstützen, ihm eine Grundlage für seine körperliche, seelische und geistige Entwicklung zu geben, Salutogenese ist hier das Stichwort. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel. Natürlich ist das ein Bereich, der nicht so einfach erforscht werden kann. Wir fördern daher als Stiftung in diesem Zusammenhang Forschungsarbeiten, die der Sichtbarmachung von Lebenskräften nachgehen, beispielsweise durch die Bildschaffenden Methoden.
Aber was sind die wirklichen Probleme und Herausforderungen bei der ökologischen Saatgutforschung- und Züchtung, warum gibt es in bestimmten Bereichen kaum ökologisches Saatgut?
Plischke: In Mitteleuropa haben wir im Getreide- und Gemüsebereich vielleicht acht oder neun Initiativen, die sich mit biologisch-dynamischer Züchtung beschäftigen. Diese Initiativen im Getreidebereich können drei bis fünf neue Sorten pro Jahr entwickeln, anmelden und verkaufen. Ein Prozess, der als solcher (bei Getreide) viele tausend Euro kostet. Die biodynamische Züchtung ist beileibe nicht voll finanziert, manche Züchter machen das neben ihrer beruflichen Tätigkeit.
Also ist die Finanzierung der Saatgutzüchtung das Problem?
Plischke: Das ist in der Tat eine große Herausforderung, denn über Rückflüsse und Lizenzen aus dem Verkauf des Saatguts allein kann die ökologische Züchtung bei Weitem nicht gedeckt werden. Momentan haben wir hier Ausgaben von ungefähr zwei Millionen Euro pro Jahr, wovon derzeit etwa 800 000 Euro über den Saatgutfonds der GLS Zukunftsstiftung Landwirtschaft getragen werden. 350 000 kommen von der SAGST, der Rest verteilt sich auf andere Zuwendungen und Spenden.
Bauer: Eine weitere Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass die bisher gezüchteten Sorten derzeit im Anbau oft geringere Erträge bringen. Das liegt daran, dass bei konventionellen Sorten, die es schon lange gibt, aufgrund der langjährigen Bearbeitung ein Züchtungsfortschritt vorliegt. Dadurch ist die Akzeptanz bei Anbauern für ökologisch gezüchtete Sorten geringer, der Druck aus dem Markt ist ja enorm, es geht ja leider oftmals mehr um die Menge als um die Qualitäten im Sinne des ökologischen Landbaus. Dazu kommt eine Uniformitätserwartung des Handels und der Zulassungsbehörden. Will heißen, der Einzelhändler denkt, dass der Kunde z.B. nur einen schneeweißen und keinen cremeweißen Blumenkohl akzeptiert.
Gibt es denn bereits konkrete Erfolgsmodelle?
Bauer: Eine ganz wichtige Rolle spielt die GLS Treuhand mit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und darin dem Saatgutfonds. Denn damit ist eine neutrale Instanz geschaffen worden, die frei von eigenen wirtschaftlichen Interessen Gelder nach Bedarf und Notwendigkeit verteilt. Dieser Fonds ist aus meiner Sicht durchaus soweit ausbaubar, dass er auch öffentliche Gelder aufnehmen kann oder größere Summen aus der Wertschöpfungskette. Der ganze Bereich befindet sich aber noch im Graswurzelstadium, da kann man noch nicht einmal von einer Nische sprechen. Ich sehe bei der Finanzierung der Saatgutforschung und -Züchtung im Wesentlichen zwei Stränge: Einerseits erfüllen die ökologischen Saatgutzüchter eine gemeinnützige Aufgabe, da Saatgut im Sinne von Biodiversität ein Kulturgut ist. Das ist im Interesse des Staates und muss daher auch unterstützt werden. Der andere Strang sind alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette.
Plischke: Ein weiteres Best-Practice ist die Initiative „Kultursaat“, ein Verein, der sich für Züchtungsforschung und Kulturpflanzenerhaltung auf biologisch-dynamischer Grundlage einsetzt. Hervorzuheben ist dabei das Projekt „Fair-Breeding“, das alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette, vom Züchter über den Händler bis zum Endkunden in die Preisgestaltung mit einbezieht. Solche Kooperationen schaffen vor allem Bewusstsein. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen bereit sind, mehr zu zahlen, aber ich muss es ihnen erklären.
Bauer: Eine sehr spannende Idee ist, den Open-Source-Gedanken aus der Software-Industrie auf den Saatgutbereich zu übertragen. Dazu haben wir von Seiten der SAGST eine Vorstudie finanziert. Aktuell liegen uns zwei Projektanträge in diesem Bereich vor, die wir gemeinsam mit der Stiftung Mercator Schweiz prüfen. Da geht es um die Weiterentwicklung des Open-Source-Gedankens und die Entwicklung konkreter Vorschläge. Ein weiterer Ansatz betrachtet den Allmende-Gedanken, die Idee gemeinschaftlichen Eigentums.
Welche Rolle kann eine Stiftung wie die SAGST hier spielen?
Plischke: Wir können als Stiftung eine Plattform bieten, Verbindungen schaffen, Kontakte herstellen, z.B. zwischen Händlern, Unternehmern und Züchtern. Wir können neutraler Moderator sein. Schlussendlich geht es natürlich auch darum, die Finanzierung sicherzustellen, womit die Stiftung eigentlich eine Staatsaufgabe übernimmt. Unser Anliegen ist es, dass die Züchtung weiterhin gut bleibt in ihrer Qualität.
Bauer: In dieser Rolle als Moderator müssen wir uns die Frage stellen, wie es weitergehen kann, damit das Thema aus der Nische kommt. Wichtig ist mir dabei auch der Assoziationsgedanke. Alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette, vom Züchter über den Vermehrer, dem Erwerbsanbau, den Händler bis hin zum Kunden müssen sich als Assoziation verstehen, deren Interesse es ist, dass jedes einzelne Glied der Kette stark ist. Da geht es beispielsweise um Wertschätzung und Preisgerechtigkeit. Ein Erwerbsanbauer, der zu wenig für sein angebautes Produkt bekommt, kann nicht nachhaltig wirtschaften, hat Schwierigkeiten aufgrund der obigen Ausführungen Saatgut aus ökologischer Züchtung zu verwenden und kann damit auch nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen zum Gesamtprozess beitragen.
Was kann der Verbraucher, was kann der Endkunde dafür tun, dass Bio drin ist wo Bio draufsteht?
Bauer: Verbraucher können viel tun. Jeder kann beispielsweise durch steuerlich abzugsfähige Spenden an den Saatgut-Fonds die ökologische Saatgut-Züchtung direkt unterstützen. Ganz praktisch kann man aber auch beim Kauf eines Produktes darauf achten, dass dieses aus samenfesten Sorten erzeugt wurde, teilweise ist das sogar auf den Verpackungen vermerkt. Letztlich kann ich durch gezieltes Nachfragen auch dazu beitragen, dass mehr Bewusstsein für dieses Thema entsteht.
Die Fragen stellte Peter Augustin.