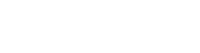„Unser Blick aufs Alter muss sich verändern!“ – Beziehungsfähigkeit ausbilden und pflegen: Umgang mit demenziell erkrankten Menschen
Der Umgang mit demenziell erkrankten Menschen stellt Angehörige und Pflegende vor große Herausforderungen. Im Altenheim Haus Aja Textor-Goethe in Frankfurt am Main wird auf diesem Gebiet schon seit Jahren vorbildliche Arbeit geleistet, auch im angegliederten Fachseminar für Altenpflege nimmt das Thema großen Raum ein. 2007 eröffnete außerdem das mehrfach ausgezeichnete Vorzeigeprojekt „Aja's Gartenhaus“ mit vier Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen mit Demenz. Diese vorbildliche Einrichtung wird von der Software AG – Stiftung seit über 15 Jahren fördernd begleitet. Wir sprachen mit Verantwortlichen aus verschiedenen Bereichen über ihren Blick auf die Demenz und die sozialen Fragen, die sie aufwirft.
Welches Menschenbild bestimmt Ihre Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen?
Uwe Scharf: Man könnte es mit dem Goethe-Zeitgenossen Heinrich Zschokke so formulieren: Der Geist wird nicht krank. Bei dementen Menschen gehen bestimmte kognitive Fähigkeiten verloren – alles andere aber, darunter auch die emotionalen Fähigkeiten, ist weiterhin gesund. Deshalb sehen wir unsere Aufgabe darin, Räume zu gestalten, in denen sich diese Menschen zurechtfinden können, eine Umgebung, in der sie angesprochen und gefördert werden können. Aber vor allem ist es wichtig, die Mitarbeiter so zu schulen, dass sie mit den Bewohnern in Beziehung treten können. Seit der Einführung der Pflegeversicherung hat sich die Klientel in Einrichtungen wie unserer stark verändert: Hierher kommen vor allem diejenigen, deren Orientierungsschwierigkeiten eine Unterbringung in häuslicher Umgebung nicht mehr erlauben. Und es ist deutlich geworden, auch hier bei uns, dass man scheitert, wenn man versucht, diese Menschen den Institutionen anzupassen. Die Menschen mit Demenz haben sich da schlicht verweigert und dadurch auch die Betreuungsformen verändert – was vorher auf sozialpolitischem Feld nicht möglich war.
Sylvia Staehle: In der Fachschule vermitteln wir das so: Das Ich bzw. der Geist sind noch da, haben aber keine Kopplung mehr an die Seele und den Körper. Folglich können die Menschen ihre Gefühle nicht mehr über ihre geistigen Fähigkeiten steuern, und es kommt deshalb manchmal zu für uns unverständlichen Reaktionen. Wenn ich aber weiß, warum das so ist und dass dieses in meinen Augen „verrückte“ Verhalten nicht gegen mich persönlich gerichtet ist, kann ich damit besser umgehen. Wichtig finde ich, dem demenziell Erkrankten seinen Geist nicht abzusprechen. Ich muss gar nicht verstehen, warum jemand etwas Bestimmtes möchte oder warum er so fühlt – ich lasse ihn in seiner Wahrheit. Das kann ich für ihn und für seine Würde tun.
Johannes Riesenberger: Deshalb ist der Begriff „Demenz“ in meinen Augen ein Unding. Wörtlich übersetzt bedeutet er „ohne Geist“ – und das ist nicht wahr!
Wie wirkt sich diese Betrachtungsweise in der Praxis aus?
Annette Wittkamp: Im Zentrum unser Arbeit steht der Versuch, mit dem anderen in Kontakt zu treten, wirkliche Begegnung herzustellen. Das ist im Umgang mit jedem Menschen wichtig, aber in der Altenpflege ganz besonders. Oft erleben wir, dass sich die Menschen nach einer Zeit hier entspannen: Dass sie wirklich ankommen und als Mensch wieder sichtbarer werden. Das versuchen wir auch im Umgang unter den Mitarbeitenden zu pflegen.
Aus dem, was Sie sagen, wird deutlich, wie wichtig es ist, die Demenz zu akzeptieren. Kann man ihr vielleicht sogar positive Seiten abgewinnen?
Johannes Riesenberger: Es wünscht sich wohl niemand, im Alter seine Steuerungsfähigkeiten weitgehend abzugeben und auf eine mehr oder weniger rein emotionale Lebensbewegung angewiesen zu sein. Und doch können wir erleben, dass die Demenz uns auf unmittelbare menschliche Qualitäten zurückführt. Die Mitarbeiter müssen an ihren eigenen seelischen Fähigkeiten arbeiten, um Toleranz und Akzeptanz zu erlernen – das kann man durchaus im Sinne eines Schulungsweges sehen. Demenzkranke Menschen merken ganz genau, wie der andere Mensch es meint: Wenn ich es eilig habe und eine Bewohnerin so organisiere, dass sie möglichst schnell zum Essen kommt, merkt sie das. Deutlich ist, dass diese Menschen uns auffordern, unsere sozialen Beziehungen anders zu gestalten: so, dass Milieus überschaubarer und von echter Wertschätzung getragen werden. Sie helfen uns zu entschleunigen und zu Qualitäten zurückzufinden, die durch Industrialisierung und Modernisierung weitestgehend verlorengegangen sind.
Was für eine Bedeutung könnte die Demenz für die Biographie eines Menschen haben?
Uwe Scharf: Manchmal entwickeln Menschen in der Demenz Fähigkeiten, die in ihren vorherigen Lebensphasen keinen Platz hatten, dort aufgrund aller möglichen Zwänge zu kurz gekommen sind. Da kann schon der Eindruck entstehen, dass sich eine Biographie auf diese Weise abrundet.
Sylvia Staehle: Wohl alle Menschen versuchen, ihre Vergangenheit zu bewältigen. Ein demenziell erkrankter Mensch, der hauptsächlich auf der Gefühlsebene lebt, setzt sich eben auf dieser Ebene damit auseinander und kann dann hoffentlich in Frieden gehen, wenn er sich emotionale Seiten zugestehen kann, die er früher verdrängt hat.
Uwe Scharf: Es gibt Hinweise darauf, dass Demenz auch im Zusammenhang mit unverarbeiteten traumatischen Erlebnissen in früheren biografischen Phasen stehen kann. Angesichts der Kriegs- und Nachkriegserfahrungen der Generation, die nun so massiv von der Demenz betroffen ist, scheint das plausibel. Ihnen standen damals keine therapeutischen Hilfen zur Verfügung – vielleicht ist die Demenz ja eine Form, die emotionale Balance wieder herzustellen? Wir versuchen das in diesem Sinne zu begleiten, ohne fertige Antworten zu haben. Das ist eine gemeinsame Suchbewegung, ein Forschungsprozess.
Wie schaffen Sie den Spagat zwischen dem Anspruch, für diese Menschen eine vertraute Umgebung und eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, und den vielen bürokratischen Vorschriften, die diese Arbeit oftmals erschweren?
Annette Wittkamp: Das ist ein tägliches Ringen. Es ist in den meisten Einrichtungen der Altenpflege normal, dass eine Pflegekraft zwischen zehn und fünfzehn Menschen am Morgen pflegen muss. Alte Menschen sind langsam, das dauert alles seine Zeit – da reichen die 20 Minuten, die für jeden angesetzt sind, einfach nicht aus. Bei uns gibt es in jeder Schicht, in jedem Bereich zusätzlich jeweils einen Fachschüler, dennoch: Der Druck ist hoch. Wie kann man da überhaupt qualitativ gute Arbeit leisten und neben den rein praktischen Dingen auch seelische Begegnungen herstellen? Dabei geht es hier doch in erster Linie um Beziehungsarbeit, und dazu braucht man einfach Zeit.
Für die Beziehungsqualität spielen auch ehrenamtliche Helfer und Angehörige ein wichtige Rolle – wie binden Sie diese ein?
Uwe Scharf: Diesen Bereich haben wir mit Aja‘s Gartenhaus neu gegriffen. Dort gibt es kleinräumige Wohneinheiten, in denen sich nicht nur die demenziell erkrankten Bewohner sicher fühlen können, sondern auch Ehrenamtliche und Angehörige schnell Orientierung finden. Außerdem haben wir zwei Teilzeitstellen geschaffen, um die ehrenamtlichen Helfer zu koordinieren und in Erstgesprächen zu klären, wo und wie deren Fähigkeiten gut eingesetzt werden können. Bei den Angehörigen ist es ähnlich, auch da versuchen wir, sie möglichst intensiv in das Leben hier einzubinden.
Annette Wittkamp: Es ist wichtig, mit den Angehörigen in Beziehung zu treten, sie sind ja meist die engsten Bezugspersonen der Bewohner. Wenn sie uns vertrauen, können sich auch die Bewohner besser entspannen. Viele Angehörige haben ein schlechtes Gewissen, weil sie die Pflege zu Hause nicht mehr bewältigen konnten – es ist wichtig, ihnen zu vermitteln, dass wir anerkennen, was sie vorher geleistet haben, dass es aber auch in Ordnung ist, nun diesen nächsten Schritt zu gehen.
Es gibt Pläne, die bisher eigenständigen Ausbildungsgänge Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege in einer gemeinsamen Ausbildung zusammenzufassen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Uwe Scharf: Für die Altenpflege bedeutet das, dass die Einsatzfelder vielfältiger werden und der Anteil der Krankenpflege zunimmt, außerdem erhöhen sich die Eingangsvoraussetzungen, weil man die Mittlere Reife braucht. Dabei haben wir in der Altenpflege in den letzten Jahren über die einjährige Altenpflegehelferausbildung und den vorgeschalteten Bundesfreiwilligendienst extra einen niedrigschwelligen Zugangsweg geschaffen. Die meisten Bewerber für die dreijährige Altenpflegeausbildung haben bisher keine Mittlere Reife, da würde also ein großer Bewerberkreis wegbrechen.
Sylvia Staehle: Die Schulung der Beziehungsfähigkeit wird bei einer generalistischen Ausbildung kaum Platz finden, darunter würden am meisten die demenziell erkrankten Menschen leiden. Wir müssten dann unsere Mitarbeiter vermutlich nachschulen – doch wer soll das finanzieren?
Uwe Scharf: Das wird eine große Herausforderung für die Altenpflege und für die anthroposophisch orientierten Pflegeeinrichtungen werden. Wir haben ja bundesweit nur fünf Ausbildungsorte, an denen in einer grundständigen Ausbildung auch das anthroposophisch erweiterte Menschenbild vermittelt wird. Es ist offen, ob wir diese Arbeit an allen Standorten aufrecht erhalten können und welche Auswirkungen diese Veränderungen hätten. Diese neuen Pflegefachmänner oder Pflegefachfrauen, so wird die Berufsbezeichnung dann lauten, werden in der dreijährigen Ausbildung vielleicht gerade einmal ein einziges Praktikum in der Altenpflege gemacht haben, das reicht natürlich nicht.
Mit Blick auf die demografische Entwicklung müssen wir davon ausgehen, dass die Anzahl der an Demenz erkrankten Menschen weiter stark zunimmt – und damit auch die Herausforderung an unsere Gesellschaft, damit umzugehen. Was wären aus Ihrer Sicht wichtige Weichenstellungen?
Uwe Scharf: Unser Blick aufs Alter muss sich verändern. Wenn wir davon ausgehen, dass das Alter und auch die Demenz wichtig sein können, um die Biographie eines Menschen abzurunden, dann ist das eine Entwicklungsphase, in der wir Menschen begleiten sollten und nicht nur notdürftig versorgen. Eine noch weitere Perspektive erhalten wir, wenn wir von wiederholten Erdenleben ausgehen: Im buddhistischen oder hinduistischen Kulturkreis gibt es die Vorstellung, dass der Zeitpunkt und die Umstände des Todes von großer Bedeutung für das nächste Leben sind.
Ich denke, dass wir auch in Zukunft die gezielte Ausbildung der Beziehungsfähigkeit brauchen, um die Beziehungen zu dementen Menschen und ihrer extremen Andersartigkeit aufbauen und halten zu können. Wenn das in der generalistischen Ausbildung verlorengeht, müssen wir andere Formen dafür entwickeln. Es geht darum, das soziale Leben menschlich und liebevoll zu gestalten und diese Arbeit mit der Perspektive eines spirituellen Menschenbildes zu erweitern. Wenn wir den Menschen als ein in Entwicklung befindliches Wesen betrachten – und zwar über den Tod hinaus – dann ergibt sich erst der eigentliche Sinn und auch die Zukunftsperspektive dieser sozialen Gestaltung.
Vielen Dank für das Gespräch!
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:
Johannes Riesenberger, Mitarbeiter im Sozialdienst
Uwe Scharf, Heimleitung und Geschäftsführung
Sylvia Staehle, Leitung des Fachseminars
Annette Wittkamp, Pflegedienstleitung
Die Fragen stellten Elke Rahmann und Konrad Lampart, Projektleitung Software AG – Stiftung.
Mehr Informationen/Links: